 Um genau zu sein durchleben Kinder in jedem Alter eine neue Phase. Die Phase der Diskussionen und der Konflikte gehören auch dazu. Zum einen testen sie andere Personen aus, wie weit sie mit ihrem Verhalten gehen können. Zum anderen wollen Kinder ihre Meinung mit aller Macht durchsetzen. Kinder leben im hier und im jetzt, für sie zählt der Moment der gerade passiert. Dass bedeutet, wenn in diesem Moment ein Konflikt ist dann muss er auch sofort geklärt werden. Für Außenstehende ist diese Situation meist Zeitaufwändig und nicht von großer Bedeutung. Für das Kind ist es doch umso wichtiger, dass eine schnelle Lösung gefunden wird.
Um genau zu sein durchleben Kinder in jedem Alter eine neue Phase. Die Phase der Diskussionen und der Konflikte gehören auch dazu. Zum einen testen sie andere Personen aus, wie weit sie mit ihrem Verhalten gehen können. Zum anderen wollen Kinder ihre Meinung mit aller Macht durchsetzen. Kinder leben im hier und im jetzt, für sie zählt der Moment der gerade passiert. Dass bedeutet, wenn in diesem Moment ein Konflikt ist dann muss er auch sofort geklärt werden. Für Außenstehende ist diese Situation meist Zeitaufwändig und nicht von großer Bedeutung. Für das Kind ist es doch umso wichtiger, dass eine schnelle Lösung gefunden wird.
Beispielsweise, es findet eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern statt. Der Streit wurde geklärt, doch für ein Kind ist das Thema noch nicht beendet. Es fängt an zu diskutieren, da es die Sachlage für falsch empfindet. Die anderen Kinder sind genervt und finden es für nicht notwendig ihm zuzuhören. Sie gehen Weg und lassen das Kind stehen. Das Kind fühlt sich nicht verstanden und fängt ein Streit an.
Wissenswerter Tipp
Indem Fall ist es bedeutsam, dass die Erwachsenen auf die Meinung eingehen und die Situation hinterfragen. „Wieso ist es so“? Geben Sie dem Kind, die Chance sich zu dem Sachverhalt zu äußern. Das Kind muss das Gefühl bekommen, selbst aktiv zu werden indem es die Problemsituation beschreibt und selbst erkennt. Bei Konflikten und Diskussionen lernen Kinder wie sie Aufgaben selbstständig bewältigen können. Es probiert sich mit Worten mitzuteilen und auf andere Kinder zu zugehen. Die Gefühle werden ausgedrückt und das Verhalten wird dabei reflektiert.

 Immer wieder endlose Diskussionen, das Kind möchte nicht ins Bett gehen. Entweder hat es Durst oder möchte auf die Toilette oder es möchte ihnen von den Tag erzählen. Es findet immer wieder neue ausreden um nicht ins Bett zu müssen. Wenn Eltern immer wieder auf die Ausflüchte der Kinder eingehen, dann sind alle Familienmitglieder einfach nur genervt und es kommt zum Dauerstreit. Am Ende des Tages fühlen sich alle schlecht, Eltern schreien und die Kinder weinen. Das schlechte Gewissen lässt einen nicht mehr los und der Schlaf wird vom Unterbewusstsein und den negativen Gedanken gestört. Doch Eltern müssen Kindern klare Grenzen setzen. Kinder haben ihren eigenen Kopf und sind eigenständige Individuen, doch ist der Schlaf keine Strafe. Schlafen ist für Kinder wichtig, gerade in der Wachstumsphase brauchen Kinder ausreichend davon. Das Gehirn verarbeitet den Tagesablauf und die erlebten Sachen. Der Körper heilt sich und lädt den Akku auf, die Sinne werden gestärkt.
Immer wieder endlose Diskussionen, das Kind möchte nicht ins Bett gehen. Entweder hat es Durst oder möchte auf die Toilette oder es möchte ihnen von den Tag erzählen. Es findet immer wieder neue ausreden um nicht ins Bett zu müssen. Wenn Eltern immer wieder auf die Ausflüchte der Kinder eingehen, dann sind alle Familienmitglieder einfach nur genervt und es kommt zum Dauerstreit. Am Ende des Tages fühlen sich alle schlecht, Eltern schreien und die Kinder weinen. Das schlechte Gewissen lässt einen nicht mehr los und der Schlaf wird vom Unterbewusstsein und den negativen Gedanken gestört. Doch Eltern müssen Kindern klare Grenzen setzen. Kinder haben ihren eigenen Kopf und sind eigenständige Individuen, doch ist der Schlaf keine Strafe. Schlafen ist für Kinder wichtig, gerade in der Wachstumsphase brauchen Kinder ausreichend davon. Das Gehirn verarbeitet den Tagesablauf und die erlebten Sachen. Der Körper heilt sich und lädt den Akku auf, die Sinne werden gestärkt. Die Lust am sprechen, mein Kind hört einfach nicht auf zu reden. Es redet und redet. Wenn es ein Thema beendet hat, fängt es einfach mit einem anderen Thema an.
Die Lust am sprechen, mein Kind hört einfach nicht auf zu reden. Es redet und redet. Wenn es ein Thema beendet hat, fängt es einfach mit einem anderen Thema an.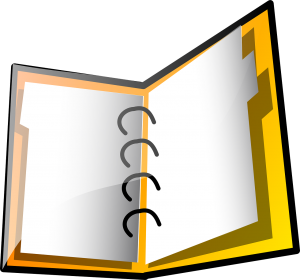 Im Praxis-Bereich der Ausbildung, sieht der Lehrplan vor einen Hefter anzulegen.
Im Praxis-Bereich der Ausbildung, sieht der Lehrplan vor einen Hefter anzulegen. Auszubildende Kinderpfleger/Sozialassistenten oder Erzieher müssen nicht nur Analysen, Planungen oder Angebote schreiben. Sie müssen diese auch reflektieren. Da kommen häufig Fragen auf, die einen Kopfzerbrechen bereiten.
Auszubildende Kinderpfleger/Sozialassistenten oder Erzieher müssen nicht nur Analysen, Planungen oder Angebote schreiben. Sie müssen diese auch reflektieren. Da kommen häufig Fragen auf, die einen Kopfzerbrechen bereiten. Beobachtungen sind fachliche gezielte und vor allem geplante Wahrnehmungen auf der Grundlage von den beruflichen Interessen ausgehend.
Beobachtungen sind fachliche gezielte und vor allem geplante Wahrnehmungen auf der Grundlage von den beruflichen Interessen ausgehend. Wieso hat mein Kind nur so viel Energie und einen unaufhaltsamen Bewegungsdrang? Diese Frage stellen sich viele Eltern, grade nach einem langen stressigen Arbeitstag kann das zur großen Herausforderung für Eltern werden.
Wieso hat mein Kind nur so viel Energie und einen unaufhaltsamen Bewegungsdrang? Diese Frage stellen sich viele Eltern, grade nach einem langen stressigen Arbeitstag kann das zur großen Herausforderung für Eltern werden.